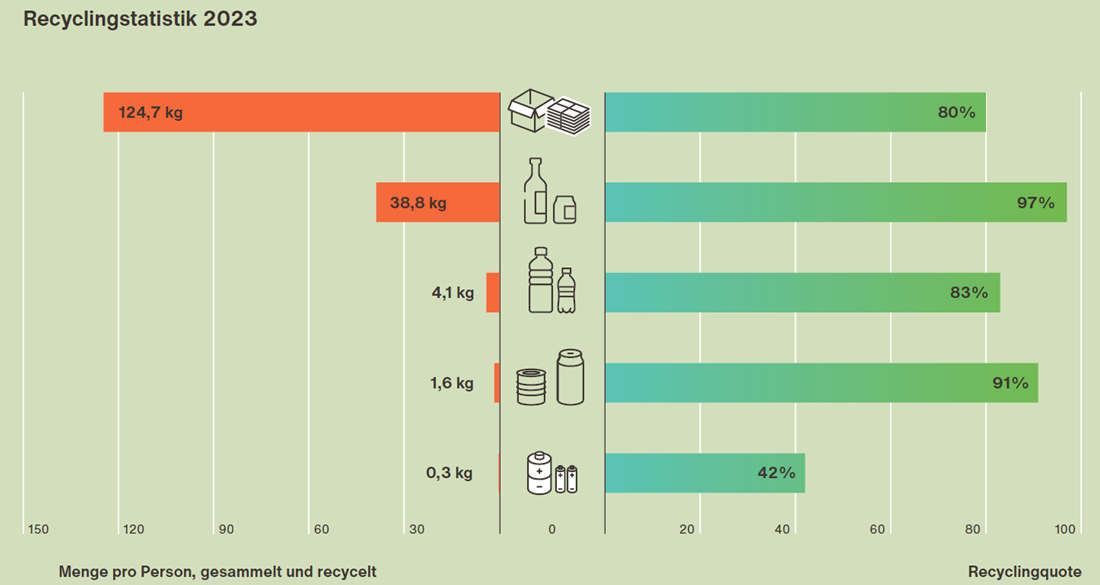Für Umwelt, Innovation und Arbeitsplätze
Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, Rohstoffe möglichst effizient zu nutzen und Produkte so lange wie möglich in Gebrauch zu halten. National- und Ständerat haben in der Frühlingssession beschlossen, diese weiter zu fördern. Ein Modell mit Zukunft.
In der Schweiz entstehen pro Person jährlich etwa 703 Kilogramm Abfall. Das sind 1,9 Kilogramm pro Kopf und Tag und zeigt exemplarisch, dass wir als Gesellschaft einen nachhaltigeren Umgang mit unserem Planeten finden müssen. Die Kreislaufwirtschaft hat dem enormen Ressourcenverbrauch den Kampf angesagt und findet immer mehr Einzug in Politik und Wirtschaft.
Von der Linie zum Kreis
Rohstoffe werden abgebaut, zu Produkten verarbeitet, von uns Konsumentinnen und Konsumenten gekauft, gebraucht und dann weggeworfen. So kann man sich den klassischen linearen Lebenszyklus vorstellen, wie wir ihn bei vielen Produkten kennen. Die Folge: Rohstoffverknappung, hohe Emissionen, grosse Abfallmengen und damit auch eine grosse Umweltbelastung. In der Kreislaufwirtschaft hingegen werden Materialien und Produkte möglichst lange im Umlauf gehalten. Dadurch verringert sich im Vergleich zum linearen Wirtschaftssystem der Ressourcenverbrauch deutlich.
Ein ganzheitlicher Ansatz
Kreislaufwirtschaft wird oft mit Recycling verwechselt. Das Wiederverwenden von Materialien ist zwar ein Bestandteil der Kreislaufwirtschaft, doch der Ansatz geht weit darüber hinaus. Er erstreckt sich von der Rohstoffgewinnung über das Design, die Produktion und Distribution sowie einer möglichst langen Nutzungsdauer bis zum Recycling des Produktes. Betrachten wir exemplarisch den Lebenszyklus eines Produktes in der Kreislaufwirtschaft: Am Anfang stellt sich die Frage, aus welchen Materialien das Produkt hergestellt werden soll. Hierbei soll ein möglichst grosser Anteil an recycelten und andernfalls möglichst nachhaltig abgebauten Rohstoff en verwendet werden. Dem Produktdesign kommt in der Kreislaufwirtschaft eine grosse Wichtigkeit zu. Produkte müssen so gestaltet werden, dass sie möglichst langlebig, reparierbar und schliesslich gut zu recyceln sind. Funktioniert beim Handy der Akku nicht mehr, soll nur dieser und nicht das ganze Handy ersetzt werden müssen.
Teilen statt besitzen
Dank robusten Designs kann die Lebensdauer von Produkten deutlich erhöht werden. Über die ganze Produktelebensdauer betrachtet, schont das in den meisten Fällen nicht nur die Umwelt, sondern auch das Portemonnaie von uns Konsumentinnen und Konsumenten. Doch nicht nur die Lebens-, sondern auch die Nutzungsdauer sollen in der Kreislaufwirtschaft optimiert werden. Klassisches Beispiel für ein Produkt mit geringer Nutzungsdauer ist die Bohrmaschine. In Privathaushalten wird diese gerade mal 11 Minuten genutzt. Und das über die gesamte Lebensdauer der Bohrmaschine betrachtet. Dass sich jeder Haushalt eine eigene Bohrmaschine anschafft, ist folglich ineffizient. Durch Teilen oder Vermieten kann die effektive Nutzungsdauer deutlich erhöht werden. Erst wenn sich ein Produkt nicht mehr länger nutzen und reparieren lässt, wird es dem Recycling zugeführt. Denn auch Recycling ist wegen des Verbrauchs von Energie, Wasser oder Chemikalien umweltbelastend. Aus dem recycelten Material werden wieder neue Produkte hergestellt, und der Kreislauf beginnt von Neuem.
Rohstoffarme Schweiz
Die Bestrebungen zur Kreislaufwirtschaft in der Schweiz reichen bereits bis in die Mitte der 80er-Jahre zurück. Als rohstoffarmes Land ist die Schweiz stark von Importen abhängig. Die vermehrte Wiederverwendung bringt aus wirtschaftlicher Sicht drei Hauptvorteile. Einerseits wird die Abhängigkeit vom Ausland reduziert, wie während der Lieferengpässe während der Corona-Pandemie oder der Blockade des Suezkanals deutlich wurde. Die Anpassungen in der industriellen Produktion schaff en zahlreiche neue Arbeitsplätze, insbesondere durch den Fokus auf Reparatur, was Menschen mit Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt unterstützt. Zudem kann ein Teil des im Ausland geschaffenen Werts zurück in die Schweiz fliessen, wenn gebrauchte Produkte hier repariert und wiederverwendet werden, was die Beschäftigung fördert und den ökologischen Fussabdruck verringert. Für die auf Innovation und Qualität ausgerichtete Schweizer Wirtschaft eröffnet die längere Produktnutzung neue Geschäftsfelder, etwa durch lokale Reparaturdienstleistungen oder die Vermietung von Produkten.
Gezielt fördern
Die Kreislaufwirtschaft bietet nicht immer die ressourcenschonendste Produktionsweise, da das Recycling und die Aufbereitung bestimmter Materialien manchmal mehr Ressourcen und Energie verbrauchen als die Verwendung von Primärrohstoff en. Trotzdem ist sie für viele Wirtschaftszweige die zukunftsweisende Ausrichtung. In der Frühlingssession haben National- und Ständerat das Umweltgesetz um einen Artikel ergänzt, der dem Bundesrat ermöglicht, Anforderungen an die Lebensdauer, Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Reparierbarkeit von Produkten zu stellen. Und das Potenzial ist riesig. Laut dem Circularity Gap Report ist die Schweizer Wirtschaft erst zu 7 Prozent zirkulär. Mit dem neuen Gesetz hat der Bundesrat nun die Möglichkeit, diesen Anteil gezielt zu erhöhen. Die Schweiz kann sich dabei auch an seinen Nachbarstaaten orientieren. Diese sind teilweise schon deutlich weiter. Frankreich beispielsweise hat das Garantierecht ausgebaut und einen Reparatur-Index eingeführt. Dieser gibt auf einer Skala von eins bis zehn an, wie einfach ein Produkt zu reparieren ist und wie gut Ersatzteile verfügbar sind. Für Firmen steigt so der Anreiz, robustere Geräte zu produzieren und Reparaturdienstleistungen anzubieten. Steuerreduktionen auf solche Reparaturleistungen wären ein weiteres Instrument.
Die Schweiz muss noch einige Schritte unternehmen, um die Kreislaufwirtschaft besser in unsere Wirtschaft zu integrieren. Dies würde allen Beteiligten zugutekommen: der Wirtschaft, der Umwelt und den Arbeitnehmenden.